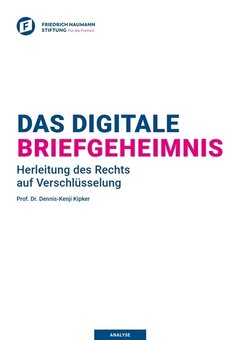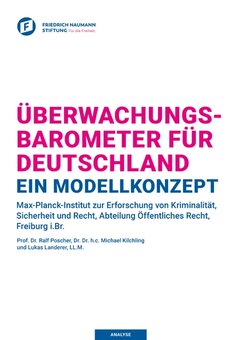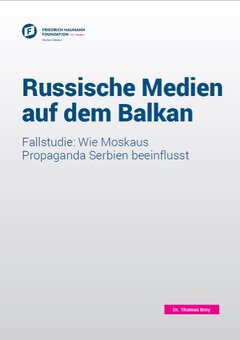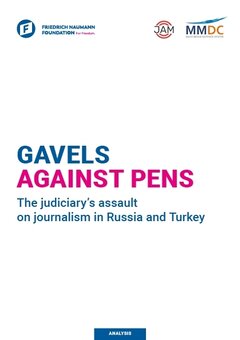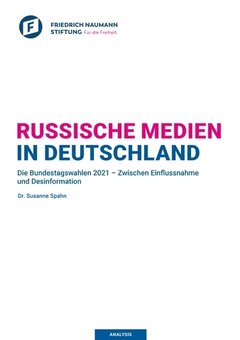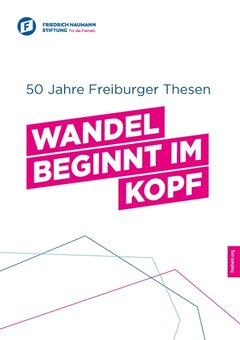Themenschwerpunkte
Der Kampf für Bürgerrechte ist liberale Kernkompetenz und für eine freie Gesellschaft essentiell. Sie werden immer wieder auf die Probe gestellt durch beispielsweise antidemokratische Tendenzen.

Eine lebendige, auf den Werten einer freien, demokratischen, toleranten und vielfältigen Gesellschaft beruhende Kulturszene und Zivilgesellschaft tragen wesentlich dazu bei, die Resilienz einer Gesellschaft gegen Extremismus und Intoleranz zu stärken.

Ohne die Medienfreiheit gehen alle Grund- und Menschenrechte einer Gesellschaft verloren. Eine Erkenntnis, die in der Epoche der Zeitenwende erneut ihre Bestätigung findet. Desinformation, Cybercrime, Hate Speech, digitale Gewalt und exzessive Attacken auf Medienschaffende greifen die Grundpfeiler des demokratischen Gemeinwesens an. Davor zu warnen und den grenzübergreifenden Medienpluralismus zu schützen ist unser Ziel und unsere Pflicht.

Demokratische Bildung ist Kernaufgabe der politischen Stiftungen und auch für die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit zentral.
- Demokratiebildung und Schülerpartizipation (PDF)
- Flyer Schulangebote Demokratie lernen (PDF)
- Reden von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (PDF)
- 50 Jahre Freiburger Thesen (PDF)
- Reden von Dr. Wolfgang Gerhardt (PDF)
- Reden von Dr. Guido Westerwelle (PDF)
- Rede von Christian Lindner - 75 Jahre liberale Politik (Video)
- Rede von Prof. PhD Christopher Clark - 75 Jahre liberale Politik (Video)
- Rede von Prof. Dr. Karl-Heinz Paqué - 75 Jahre liberale Politik (Video)
- Prof. Dr. Ewald Grothe im Gespräch mit Prof. PhD Christopher Clark (Video)