75 Jahre Grundgesetz
75 Jahre Grundgesetz: Freiheit durch Recht in der Bewährung
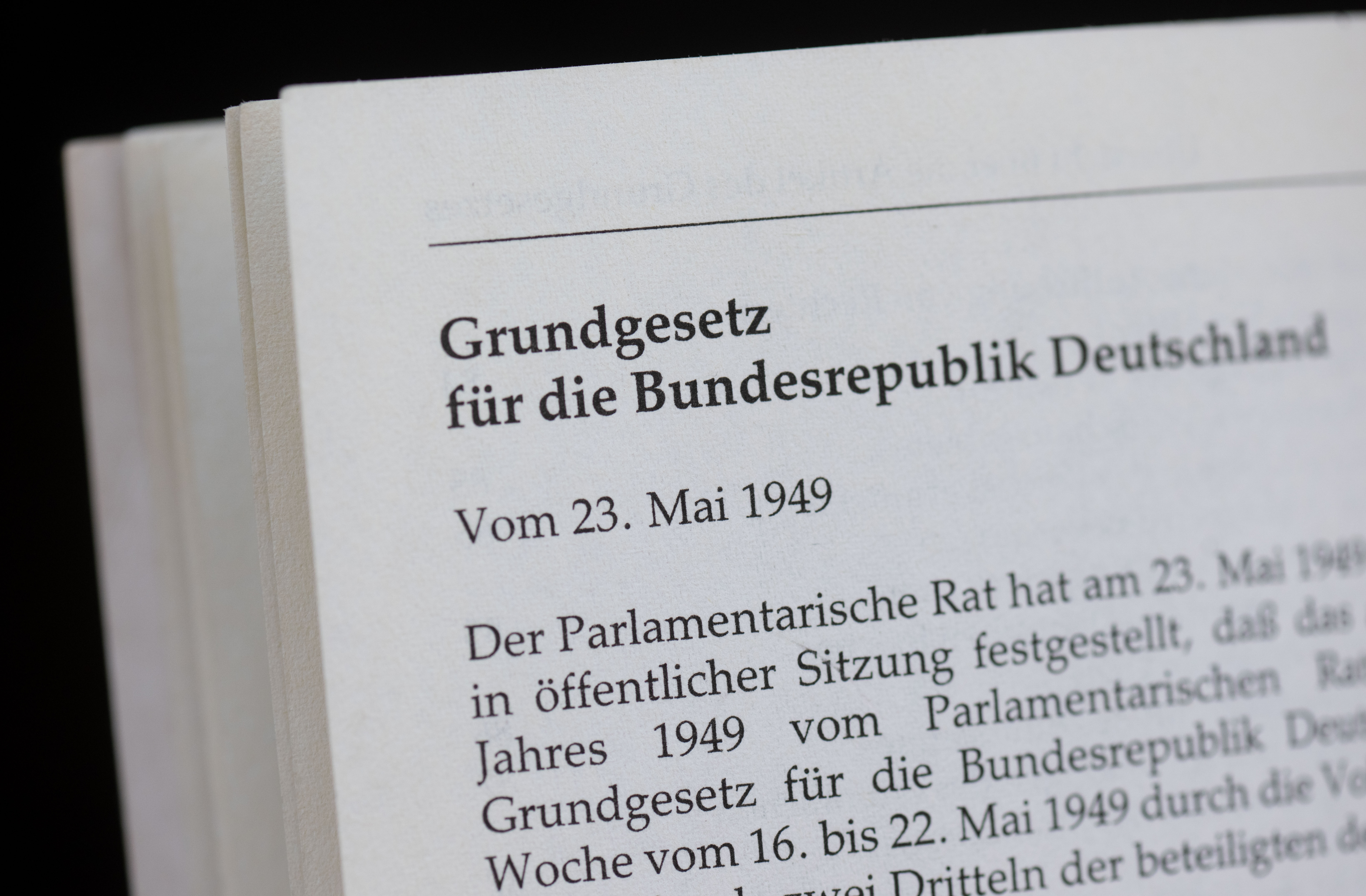
Seite aus dem Grundgesetz
© picture alliance/dpa | Hendrik SchmidtDer ehemalige Bundesverfassungsrichter Andreas Paulus beleuchtet Im Rahmen unserer Publikation „75 Jahre Grundgesetz: Wie demokratiefest ist unsere Verfassung?“ in seinem Beitrag „Freiheit durch Recht in der Bewährung" die Stärken und Schwächen des Grundgesetzes seit seiner Verkündung 1949. Der Beitrag erschien leicht geändert bereits am 17. Mai 2024 bei FAZ Einspruch.
Als Konsequenz aus dem selbstverschuldeten Weltkrieg und der nationalsozialistischen Gewalt- und Unrechtsherrschaft haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes eine Verfassung geschaffen, die Deutschland 75 Jahre inneren und äußeren Frieden beschert hat. Durch den Beitritt der neuen Länder im Jahr 1990 hat uns diese Verfassung die Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit beschert – der bisherige Höhepunkt deutscher Geschichte. Vor allem aber hat der Geniestreich des Art. 1 des Grundgesetzes, die Verankerung aller Staatlichkeit in der Menschenwürde und in unveräußerlichen Menschenrechten, die für alle deutsche Staatsgewalt – selbst bei Tätigkeit im Ausland – gilt, das deutsche Staatswesen vom Kopf auf die Füße gestellt, inspiriert von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948. Wie in der Formulierung des Verfassungsentwurfs von Herrenchiemsee vom August 1948 ist der Staat nunmehr allein um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Staates willen. Das Grundgesetz ist eine Verfassung der Freiheit aller seiner Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, ja aller in seinem Geltungsbereich lebenden Menschen. Der Diskriminierungsschutz wurde schon 1949 dank des Einsatzes der Verfassungsmütter auf die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern auch im Zivilrecht ausgeweitet; nichteheliche Kinder sind nun endlich wirklich gleichberechtigt; die Gleichberechtigung gleichgeschlechtlicher Paare erscheint dank Gesetzgeber und Bundesverfassungsgericht nach (zu) langem Vorlauf nunmehr gesichert; die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung wurde seit 1949 wesentlich vermindert. Kinderrechte sind zwar nur andeutungsweise im Wortlaut, sehr wohl aber in der Anwendung des Grundgesetzes garantiert, so im vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) herausgearbeiteten „Recht auf Bildung“.
Nüchterne Institutionen mit guter Bilanz
Die Institutionen bleiben nüchtern, allem Pomp einer um sich selbst kreisenden Staatlichkeit abhold. Der Bundestag ist ein Arbeitsparlament, welches trotz des Aufschwungs vor allem rechter Extremisten zuverlässig Gesetze verabschiedet und dabei die Grundrechte und Freiheiten seiner Bürger untereinander sorgsam abwägt. Der Bundesrat sorgt sich nicht nur um regionale Interessen, sondern auch die Durchführbarkeit der Gesetze durch die überwiegend den Ländern obliegende Verwaltung. Das Bundesverfassungsgericht hat sich aus bescheidenen Anfängen zum energischen Verteidiger der Freiheit aufgeschwungen – auch wenn nicht jede seiner Entscheidungen allen gefallen können, ist seine Popularität nur mit der des Bundespräsidenten vergleichbar. Dieser ist Staatsrepräsentant und -notar, nicht parteipolitischer Akteur. Das Bekenntnis zur europäischen und internationalen Integration hat die europäische Mittelmacht und Handelsnation wohlhabend gemacht und ihre Freiheit bewahrt. Angesichts dieser Bilanz mutet alle Kritik geradezu kleinlich und undankbar an, ob am reformunwilligen kooperativen Föderalismus, an der Entwicklung von der Kanzlerdemokratie zur Koalitionsregierung als permanentem Vermittlungsausschuss oder am Korsett einer als zu eng empfundenen Schuldenbremse.
Herausforderungen für unsere Verfassung
Verfassung. Das deutsche Schönwetter-„Geschäftsmodell“ der letzten Jahrzehnte trägt nicht mehr – hing doch nach Constanze Stelzenmüller die militärische Sicherheit am Tropf der Vereinigten Staaten, die Energieversorgung am Russland Putins und der Außenhandel der Exportnation an der Volksrepublik China. Die USA scheinen – unabhängig vom Wahlausgang im November – immer weniger bereit, die europäischen Kastanien aus dem Feuer zu holen, Putin führt seinen Angriffskrieg zur Wiedererlangung des sowjetischen Imperiums unbeirrt von der Hilfe für die Ukraine weiter, und China schwächelt wirtschaftlich, bastelt aber weiter mit Russland an einer Alternative zur liberalen Weltordnung. Europa muss eigenständiger werden, sein Militär stärken, autarker werden. Schließlich erfordert der globale Klimawandel eine Zusammenarbeit aller Wirtschaftsmächte beim Umbau der eigenen Wirtschaft, um die Emissionen von Klimagasen, insbesondere dem für den traditionellen Verbrennermotor unvermeidlichen CO₂-Ausstoß, auf ein gerade noch erträgliches Maß zu reduzieren.
Was bedeutet das für unsere Verfassung? Einiges kann der neuen Lage durch Auslegung angepasst werden, wie dies das BVerfG in seinem Klimabeschluss zu zeigen versucht hat. Dabei ist es viel weniger weit gegangen, als dies einige Kritiker wahrhaben wollen – es hat vor allem den Bundestag selbst dazu angehalten, den selbst übernommenen Verpflichtungen Taten folgen zu lassen, um den Anforderungen des Art. 21a GG für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen gerecht zu werden. Anderes kann und muss der Gesetzgeber regeln, von der Generationengerechtigkeit bei Rente und Verschuldung bis zur Ausstattung der Streitkräfte. Schließlich werden soziale Grundrechte gerade von Minderheiten, die im Grundgesetz nur ansatzweise geregelt sind, in einer Gesellschaft immer wichtiger, in der die Mehrheit selbst in Krisenzeiten ihr wirtschaftliches Wohlergehen bekundet.
Der russische Angriffs- und der israelische Verteidigungskrieg stellen nun aber Grundfesten der deutschen Wertordnung in Frage: Der Glaube an die Etablierung einer weltweiten „Herrschaft des Rechts“ in einer „regelbasierten Weltordnung“, wie dies bereits der andere deutsche Jubilar dieses Jahres, Immanuel Kant, vorausgedacht hatte, erscheint erschüttert. Die israelische Verteidigung gegen das Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 ruft die deutsche „Staatsräson“ der unverbrüchlichen Solidarität mit Israel auf. Der Begriff klingt allerdings mehr nach unbedingter staatlicher Selbsterhaltung à la Machiavelli als nach Verpflichtung des Staates auf die gleiche Würde aller Menschen. Die Solidarität mit Israel als jüdischem und demokratischem Staat ist aber Ausdruck dieser Verpflichtung. Die Versammlungsfreiheit schützt auch den Protest gegen die israelische Kriegführung in Gaza. Doch verpflichtet dies nicht zur Duldung der Infragestellung der Existenz Israels als jüdischen und demokratischen Staat, schon gar nicht durch Wiederholung der Parolen der mit Recht wegen Verstoßes gegen das Gebot der Völkerverständigung verbotenen Hamas. Jeder Protest muss die Universität als Ort des friedlichen Dialogs und Austauschs von Argumenten achten, der von Lehr- wie Wissenschaftsfreiheit geschützt ist; und damit auch die Integrität der Studierenden aus aller Welt. Die Angehörigen aller Religionen haben einen Anspruch auf gleiche Freiheit. Antisemitismus kann aber in keiner Form hingenommen werden.
Die „Ewigkeitsklausel“
Schließlich stellt sich immer stärker die Frage nach der Verteidigung der Freiheit gegenüber denjenigen, die in der Demokratie nur ein Instrument zum Machterwerb sehen, sie aber als Herrschaft einer stets feststehenden „wahren“ Mehrheit über die Minderheit und nicht als kollektive Selbstregierung aller (miss)verstehen. Dabei sind Mehrheit und Minderheit keine feststehenden Gruppen, sondern insbesondere in einer so vielschichtigen Gesellschaft wie der deutschen abhängig von der jeweils gestellten Frage. Gleichzeitig sind bestimmte Grundlagen in der Verfassung, außer Streit zu stellen. Dies leistet die sog. Ewigkeitsklausel des Art. 79 Abs. 3 GG für Menschenwürde, den Kern der Menschenrechte, Demokratie, Sozialstaat und Föderalismus. Verfassungsänderungen, welche die Widerstandsfähigkeit der liberalen Demokratie gegen die Angriffe ihrer Feinde erhöhen, sind willkommen, insbesondere zur Absicherung des Bundesverfassungsgerichts – auch wenn sie das zentrale Dilemma nicht lösen können, den Richterinnen und Richtern überparteiliche Legitimation zu vermitteln, ohne durch Sperrminoritäten erpressbar zu werden. Der Schutz der Verfassung kann aber die demokratische Legitimität aus der Wahlurne nicht ersetzen. Fast ebenso wichtig ist der Protest gegen die Feinde der gleichen Freiheit aller Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, der sich in den deutschlandweiten Demonstrationen gegen das Ansinnen einer „Remigration“ von Menschen jeder Herkunft manifestiert hat.
Unsere Verfassung in Europa
Art. 23 GG stellt klar, dass auch die europäische Einigung an den grundlegenden Verfassungsgarantien nicht rütteln darf. Dem ist zuzustimmen, soweit es gelingt, diesen Kern im – zur Not auch streitigen – Dialog mit dem Gerichtshof der Europäischen Union zu entwickeln; denn die Einheit und Wirksamkeit der europäischen Rechtsordnung ist zur Bedingung des Erfolges unserer Verfassungsordnung geworden. Einer weiteren Grundgesetzänderung, gar einer neuen Verfassung bedarf es für die weitere europäische Integration nicht, sondern nur bei Aufgehen unseres Gemeinwesens in einen europäischen Einheitsstaat, den ohnehin niemand will. Die Abstimmung über eine neue Verfassung gefährdete nur die Akzeptanz des Grundgesetzes bei über 70 Prozent der Bevölkerung.
Die Zwischenstellung Europas zwischen Bundesstaat und Staatenbund als Verfassungsverbund liberaler Demokratien ist das europäische Erfolgsgeheimnis schlechthin, das immer wieder demokratisch bestätigt werden muss. Zur Kontrolle europäischer wie nationaler Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bleibt ein umfassender Schutz individueller Grundrechte durch deutsche und europäische Gerichte von zentraler Bedeutung. So sehr wir das Grundgesetz feiern; seine Integration in den europäischen Verfassungsverbund ist Teil seiner europäischen Sendung, die bereits 1949 in seiner Präambel mit dem Ziel angelegt war, „als Glied eines vereinten Europas dem Frieden der Welt zu dienen“. Diese Bestimmung zur „Freiheit durch Recht“ bleibt auch nach 75 Jahren so jung wie am ersten Tag. Ihre Bewahrung ist aber nicht nur der Verfassung selbst, sondern allen Bürgerinnen und Bürgern aufgegeben.

