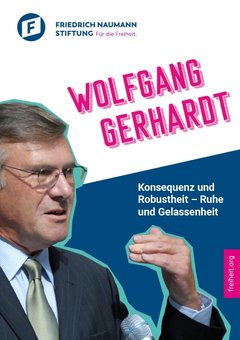Wolfgang Gerhardt
Wolfgang Gerhardt – Bürgerliche Politik in Umbruchzeiten

Dr. Wolfgang Gerhardt
© FNFAls die FDP sich am zweiten Juni-Wochenende 1995 in der Mainzer Rheingoldhalle zu ihrem Bundesparteitag traf, hatte sie turbulente Wochen und Monate hinter sich. Nach dem mit 6,9 Prozent schlechten Ergebnis der Liberalen bei der Bundestagswahl 1994 (nachdem die FDP bei der Bundestagswahl 1990 noch auf 11,0 Prozent gekommen war), nach zum Teil ebenfalls sehr schlechten Ergebnissen bei Wahlen in den Bundesländern und angesichts eines zunehmenden Ansehensverfalls der schwarz-gelben Bundesregierung unter Bundeskanzler Helmut Kohl war der Bundesvorsitzende der FDP, Bundesaußenminister Klaus Kinkel, hart kritisiert worden. Die Aussprache auf dem Bundesparteitag im Dezember 1994 in Gera war hart; Kinkel sah sich gezwungen, eine (in der Parteisatzung nicht vorgesehene) „Vertrauensfrage“ zu stellen und gewann diese. Beim Bundesparteitag in Mainz trat er dann nicht mehr für den Vorsitz an.
Nun wurde eine Persönlichkeit gesucht, die die FDP aus der Agonie des Bundestagswahlergebnisses und aus den Streitereien um den zukünftigen Kurs und die politische Ausrichtung in eine bessere Zukunft führen konnte. Wolfgang Gerhardt, seit 1982 jeweils Stellvertreter der FDP-Bundesvorsitzenden Hans-Dietrich Genscher, Martin Bangemann, Otto Graf Lambsdorff und Klaus Kinkel, wurde am 10. Juni 1995 in dieses Amt gewählt.
1965, mit 21 Jahren und noch mitten im Studium, war Wolfgang Gerhardt der FDP beigetreten. Zunächst hatte er sich in der Hochschul- und Jugendpolitik engagiert, 1967/68 als Landesvorsitzender des Liberalen Studentenbundes Deutschlands und stellvertretender Landesvorsitzender der Deutschen Jungdemokraten in Hessen. Von 1969 an hatte er bei der Friedrich-Naumann-Stiftung gearbeitet, war dann 1971 als persönlicher Referent des Ministers Hanns-Heinz Bielefeld ins hessische Innenministerium gewechselt, wo er unter dessen Nachfolger Ekkehard Gries das Ministerbüro geleitet hatte.
Für Gerhardt als „homo politicus“ war der Weg in die aktive Politik damit vorgezeichnet und das Rüstzeug war erworben. Nach einer erfolglosen Kandidatur 1974 im Wahlkreis 15/Fulda-Nord und Vogelsbergkreis-Ost und auf der FDP-Landesliste (Platz 13) zog er nach der Landtagswahl 1978 in den Hessischen Landtag ein. Schnell erwarb er sich den Ruf als guter Debattenredner und als Fachpolitiker und gehörte dem Innen- und Kulturpolitischen Ausschuss des Landtags an. In der damals aus sieben Personen bestehenden Landtagsfraktion gab es zudem viele Möglichkeiten, sich als politischer Generalist einer Regierungsfraktion einzubringen und weiterzuentwickeln.
1982 sah sich die FDP in Hessen, wie im Bund, aufgrund des Koalitionswechsels in Bonn in schwieriger Lage. Gerhardt wurde zum Landesvorsitzenden gewählt, „nicht zuletzt, weil er in dieser schwierigen Situation den Mut aufbrachte, Verantwortung für den weiteren Weg des hessischen FDP-Landesverbandes zu übernehmen“, wie ein Zeitzeuge es kommentierte. Er stand nun, wie er später in einem Interview selbst sagte, vor der Aufgabe, „die Partei mit großer persönlicher Kraftanstrengung aus dem Sumpf zu ziehen“.
Die Zeit Wolfgang Gerhardts an der Spitze der hessischen FDP lässt sich als Konsolidierung nach der Krise in 1982 beschreiben, mit nicht nur der Rückkehr in den Landtag, sondern auch mit der Regierungsbeteiligung 1987. So schreibt ein Kommentator: „Die FDP Hessen stellt sich seit Mitte der 1980er Jahre nach Struktur und Funktion im Parteiensystem als eine relativ stabile Größe dar. Sie ist und war fest im bürgerlichen Lager mit der CDU verankert und versteht sich als ‚liberales Korrektiv‘ mit einer stark wirtschaftsliberalen Ausrichtung.“
Zu Beginn der 1990er Jahre richtete sich das Augenmerk Wolfgang Gerhardts verstärkt auf bundes- und europapolitische Zusammenhänge. Seit 1982 Mitglied im FDP-Bundesvorstand, seit 1985 Stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP, hatte Gerhardt nun „für sich und mit der Partei entschieden […], seine weitere politische Laufbahn in Bonn fortzusetzen. Nach drei Jahren erneuter Amtszeit als Vorsitzender verließ er die hessische Landtagsfraktion und zog nach der Bundestagswahl 1994 über die hessische Landesliste als Abgeordneter ins Bonner Parlament ein. Dort übernahm er den Themenbereich der Bildungs- und Forschungspolitik.
Sein Weg in Bonn führte ihn kurz danach an die Spitze der FDP: Wolfgang Gerhardt gewann beim Bundesparteitag 1995 in Mainz die Abstimmung gegen Jürgen Möllemann deutlich. Grund dafür war sicherlich auch seine schon bewiesene Fähigkeit, unterschiedliche Interessen und Auffassungen konstruktiv zusammenzuführen, so wie er es auch in seiner Rede auf dem Parteitag formulierte: „Angesichts unserer eigenen Geschichte, des Pendelausschlags deutscher Politik, ist der Zwang zur Mitte hin notwendiger und unentbehrlicher Bestandteil der Politik der Liberalen, und er ist für unser Land notwendig. Gerade jetzt, wo es noch mehr zusammenwachsen muss, darf die Politik nicht von den Rändern her bestimmt werden.“
Die Rolle Wolfgang Gerhardts veränderte sich dann in der neuen politischen Konstellation nach dem Ende der christlich-liberalen Koalition 1998 deutlich. Die FDP befand sich nun in der Opposition, die Arbeit für Partei und Fraktion änderte sich. Nach nahezu 39 Jahren ununterbrochener Mitwirkung in der Bundesregierung, in der die tägliche und die langfristige politische Agenda durch die Schwerpunktsetzungen der Regierungsarbeit wesentlich bestimmt worden waren, mussten eigene, zwischen Partei und Bundestagsfraktion synchronisierte Inhalte gesetzt und Schwerpunkte gefunden werden. Um in der für die FDP angespannten Situation die Kräfte zu bündeln, beanspruchte Wolfgang Gerhardt neben dem Parteivorsitz auch den Vorsitz der FDP-Bundestagsfraktion für sich. Gestalten und moderieren – das waren Gerhardts vornehmliche Aufgaben in diesen Zeiten. Gleichzeitig konnte er in der neuen Rolle noch stärker als zuvor seine Leidenschaft für politische Grundsatzarbeit ausleben und gleichzeitig noch stärker als vorher seine außenpolitischen Ambitionen vorantreiben. Wolfgang Gerhardt führte Partei und Bundestagsfraktion mit Ruhe und der ihm eigenen Gelassenheit auch in schwierigen Situationen durch die ersten Jahre als Oppositionspartei.
Im Januar 2001 verständigten sich Wolfgang Gerhardt und Guido Westerwelle darauf, dass Gerhardt beim anstehenden Bundesparteitag nicht mehr zum Bundesvorsitz kandidieren und sein bisheriger Generalsekretär Westerwelle sich um dieses Amt bewerben, während der Vorsitz der Bundestagsfraktion weiterhin bei Gerhardt verbleiben solle.
Nachdem durch das Ergebnis der Bundestagswahl 2005 eine Regierungsbeteiligung der FDP nicht zustande gekommen war, meldete der FDP-Bundesvorsitzende Guido Westerwelle sein Interesse an einer Übernahme auch des Vorsitzes der Bundestagsfraktion an, um die Arbeits- und Abstimmungsstrukturen der Liberalen auf Bundesebene zusammenzuführen, so wie es auch Wolfgang Gerhardt 1998 getan hatte. Nach Diskussionen innerhalb der FDP-Bundestagsfraktion einigte man sich darauf, dass Wolfgang Gerhardt für ein weiteres Jahr an der Spitze der Bundestagsfraktion bleiben und danach in den Vorstandsvorsitz der Friedrich-Naumann-Stiftung wechseln sollte. Die schwierige Zeit nach der nicht erfolgreich absolvierten Bundestagswahl nutzte Gerhardt, um die in Teilen neue Bundestagsfraktion „auf den Weg“ zu bringen. Im Mai 2006 erfolgte vereinbarungsgemäß der Wechsel im Amt des Fraktionsvorsitzenden.
Nach seiner Wahl zum neuen Vorstandsvorsitzenden im Mai 2006 durch das Kuratorium der Stiftung leitete Wolfgang Gerhardt frühzeitig eine Neustrukturierung und inhaltliche Präzisierungsschritte bei der Stiftung ein. Seine Vorstellungen zur Arbeit der Stiftung, maßgeblich auch im von ihm hoch geschätzten Bereich der internationalen Politik, feilte er zurecht und formulierte sie aus.
„Freiheit“ war schon lange Wolfgang Gerhardts Kernthema gewesen. In vielen Reden und Publikationen hatte er seinen Begriff von Freiheit definiert und dargestellt. Spätestens als führender Repräsentant der Friedrich-Naumann-Stiftung hatte er nun die Gelegenheit, ohne parteipolitische oder parlamentarische Zwänge seine ganz grundsätzliche Auffassung von Freiheit durchzudeklinieren. Am 25. September 2018 übergab er den Stiftungsvorsitz an Karl-Heinz Paqué und konnte dabei auf die bis dahin längste Amtszeit eines Vorstandsvorsitzenden der Friedrich-Naumann-Stiftung (für die Freiheit) zurückblicken.
Wolfgang Gerhardt starb am 13. September 2024 in Wiesbaden. Den Bruch der „Ampelkoalition“ und das Ergebnis der Bundestagswahl 2025 musste er nicht mehr miterleben. „Die Freiheit ist noch nicht gewonnen“, hatte er immer wieder gemahnt.