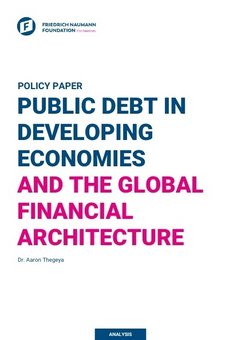G20
Neugestaltung der globalen Finanzarchitektur

World Bank on glass building. Mirrored sky and city modern facade.
© ShutterstockAngesichts der zunehmenden Verschärfung der Schuldenproblematik und des schrumpfenden fiskalischen Spielraums in Entwicklungsländern versammelten sich Experten und politische Entscheidungsträger auf Einladung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, um die Rolle der globalen Finanzarchitektur bei der Förderung oder Hemmung wirtschaftlicher Resilienz im Globalen Süden kritisch zu hinterfragen.
Im Zentrum der Debatte steht eine ernüchternde Realität: 35 Entwicklungsländer stehen kurz vor dem Zahlungsausfall, neun von ihnen befinden sich bereits in akuter Schuldennot – allesamt Volkswirtschaften mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. Weitere 26 Staaten in Subsahara-Afrika gelten als hochgradig gefährdet. Alarmierend ist, dass viele dieser Länder mittlerweile mehr für Zinszahlungen als für Bildung und Gesundheit ausgeben – ein gefährlicher Paradigmenwechsel zulasten nachhaltiger Entwicklung.
Die Kosten der Kreditaufnahme steigen und setzen ohnehin schon fiskalisch eingeschränkte Volkswirtschaften zusätzlich unter Druck. Während der Anteil der öffentlichen Schulden von Ländern mit niedrigem Einkommen weniger als ein Prozent der globalen Verschuldung ausmacht, sind die sozialen und wirtschaftlichen Folgen gravierend. Im Gegensatz dazu halten Hochlohnländer 71 Prozent der weltweiten Staatsschulden – ein deutliches Zeichen für das Ungleichgewicht im internationalen Finanzsystem. Die Problematik liegt nicht nur in der Höhe der Verschuldung, sondern auch in deren Struktur, den Gläubigern und der Frage, ob Schulden Entwicklung ermöglichen oder behindern.
Trotz ihres geringen Anteils an der weltweiten Verschuldung tragen Entwicklungsländer eine unverhältnismäßig hohe Last an Entwicklungs- und Sozialkosten. Wenn Schuldendienste dringend benötigte Mittel von Gesundheit, Bildung und Infrastruktur abziehen, sind die Folgen unübersehbar – von wachsender Ernährungsunsicherheit in Ghana bis zum Stillstand bei den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Die Schuldenkrise ist somit nicht nur ökonomisch, sondern auch sozial und politisch brisant.





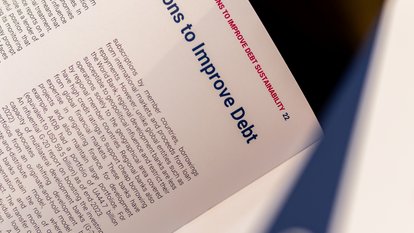
Ein dysfunktionales System?
Dr. Aaron Thegeya, Autor des zentralen Strategiepapiers der Stiftung, konstatiert einen grundlegenden Konstruktionsfehler der internationalen Finanzarchitektur: „Die Schuldenfragilität ist kein Sammelsurium isolierter Ereignisse. Sie ist systemisch und weitverbreitet, getrieben von strukturellen Ungleichheiten bei der Entstehung, Verwaltung und Neuverhandlung von Staatsschulden.“
Zu den gravierendsten Schwächen zählt die Währungsstruktur der Schulden. Während Industrieländer überwiegend in eigener Währung verschuldet sind, tragen Entwicklungsländer häufig Verbindlichkeiten in Fremdwährungen – meist US-Dollar – und sind damit Wechselkursschwankungen und steigenden Zinsen im globalen Norden ausgesetzt.
Multilaterale Schulden, oft zu günstigen Konditionen vergeben, erweisen sich ebenfalls als wenig flexibel. Institutionen wie die Weltbank, die auf ihre AAA-Ratings bedacht sind, zeigen sich selbst in humanitären Krisen restriktiv bei Umschuldungen. Regierungen in Entwicklungsländern stehen daher vor der Wahl zwischen fiskalischer Verantwortung und sozialer Unruhe – wie die Proteste in Ghana infolge von Inflation, Schuldenlast und Sparmaßnahmen belegen.
„Schuldeninstabilität ist keine Abfolge isolierter Ereignisse. Sie ist systemisch und weit verbreitet und wird durch strukturelle Ungleichheiten bei der Entstehung, Verwaltung und Neuverhandlung von Staatsschulden verursacht.“

Wiederkehrende Geschichte
Die Schuldenkrisen der Entwicklungsländer sind kein neues Phänomen. Von der lateinamerikanischen Krise der 1980er Jahre bis zur Asienkrise 1997 zeigt die Geschichte: Niedrige Zinsen und rasche Kreditaufnahme, gepaart mit externen Schocks und politischer Instabilität, bilden den Nährboden für Krisen.
Auch in den 2020er-Jahren setzt sich dieses Muster fort – verschärft durch die COVID-19-Pandemie, geopolitische Turbulenzen und eine abrupte Abkehr von lockerer Geldpolitik. Länder, die zuvor massiv für Infrastruktur investierten – oft im Rahmen von Chinas Belt-and-Road-Initiative – kämpfen nun mit steigenden Rückzahlungen und begrenztem Wachstum.
Die Instrumente für eine geordnete Umschuldung bleiben unzureichend. Der nach der Pandemie eingeführte Common Framework for Debt Treatments kommt nur schleppend voran. Bislang haben lediglich vier Länder – Tschad, Äthiopien, Ghana und Sambia – daran teilgenommen; die Verhandlungen verlaufen langsam und politisch aufgeladen. Die wachsende Vielfalt der Gläubiger, darunter China als gewichtiger Akteur außerhalb des Pariser Clubs, erschwert die Koordination zusätzlich.
Schulden, Politik und die fragile Mitte
Die Expertenrunde war sich einig: Wirtschaftliche Schocks sind unvermeidlich, doch die Reaktionen darauf entscheiden über Erholung oder Kollaps. Dr. Roshan Perera betonte die Notwendigkeit rascher und entschlossener Maßnahmen im Schuldenmanagement und forderte verbesserte Rahmenbedingungen und eine stärkere fiskalische Planung. Dr. Christopher Mugaga hob hervor, dass Schulden in Entwicklungsländern untrennbar mit politischen Prozessen verbunden sind. Die disziplinierte Umsetzung von Beschlüssen, insbesondere jenen mit Auswirkungen auf einkommensschwache Bevölkerungsteile, sei essenziell zur Bewältigung von Schuldenkrisen.
Jordan Griffith warf einen kritischen Blick auf den südafrikanischen Fiskalkurs und äußerte Zweifel, ob das Land seine Schuldenrisiken effektiv steuert. Er unterstrich die Notwendigkeit einer kohärenten Abstimmung zwischen Zentralbankpolitik und Staatsausgaben und warnte, dass mangelnde Transparenz im Haushaltswesen Schuldenkrisen zu politischen Brandherden machen und das Vertrauen der Öffentlichkeit untergraben kann.
Globale Architektur, lokale Folgen
Obwohl Entwicklungsländer nur einen kleinen Teil der globalen Schulden halten, sind sie überproportional von Schuldenfragilität betroffen. Institutionen wie der IWF und die Weltbank – meist vorrangige Gläubiger – strukturieren Vereinbarungen oft so, dass die Rückzahlung ihrer Forderungen Vorrang vor der langfristigen Resilienz der Schuldnerländer hat. Elizabeth Sidiropoulos wies auf einen grundlegenden Irrtum hin: „Einige der in den letzten Jahren geschaffenen Instrumente behandeln Schulden, als handele es sich um ein Liquiditätsproblem, obwohl es in vielen Fällen ein Solvenzproblem ist.“ Diese Fehldiagnose führt zu ungeeigneten politischen Maßnahmen und perpetuiert die Schuldenspirale.
Geschlossene Volkswirtschaften, die kaum am Welthandel teilnehmen, sind besonders anfällig für untragbare Schuldenlasten. Ohne ausreichende Deviseneinnahmen, etwa durch diversifizierte Exporte, geraten diese Staaten zunehmend unter fiskalischen Druck.
„Schnelle Reaktionen sind entscheidend, um die Volkswirtschaften zu schützen und langfristige Schäden zu vermeiden.“

Fragile Fundamente und der Weg nach vorn
Die Schuldenkrisen der 2020er-Jahre folgen einem bekannten Muster: ambitionierte Kreditaufnahme, globale Schocks, Krise und unzureichende Reaktion. Das Erstarken privater und nicht-traditioneller Gläubiger – insbesondere Chinas – erschwert die Verhandlungen zusätzlich. Traditionelle Mechanismen wie der Pariser Club oder der Common Framework gelten zunehmend als überholt.
Aus der Expertenrunde und Dr. Thegeyas Analyse ergeben sich mehrere politische Prioritäten:
- Staatlich kontingente Schuldinstrumente (SCDIs): Diese passen die Rückzahlungsmodalitäten an die makroökonomische Entwicklung an und entlasten in Abschwungphasen.
- Regionale Entwicklungsbanken wie die Afrikanische Entwicklungsbank setzen auf Modelle, bei denen Projekte initiiert und das Risiko an private Investoren – idealerweise in Lokalwährung – weitergegeben wird.
- Mehr Transparenz in der öffentlichen Finanzverwaltung, etwa durch ergebnisbasierte Finanzierungen, bei denen Rückzahlungen an nachgewiesene Entwicklungsfortschritte geknüpft werden.
- Schulden-für-Klima-Tauschgeschäfte, die es Ländern ermöglichen, Auslandsschulden abzubauen und zugleich wichtige Klimaanpassungsmaßnahmen zu finanzieren – ein wachsender Bedarf in besonders verwundbaren Regionen.
Fazit: Politische und wirtschaftliche Notwendigkeit
Während der Schuldendienst einen immer größeren Anteil der nationalen Haushalte beansprucht, steigen die sozialen Kosten – Armut, Hunger, Ernährungsunsicherheit und soziale Unruhen nehmen zu. Staatsschulden können ein Motor für Entwicklung sein, wenn sie transparent, diszipliniert und koordiniert gesteuert werden.
Die Botschaft der Expertenrunde ist eindeutig: Die gegenwärtige globale Finanzarchitektur ist nicht mehr zeitgemäß. Ohne rasche und umfassende Reformen droht Millionen Menschen im Globalen Süden ein dauerhafter Teufelskreis aus Verschuldung ohne nachhaltigen Nutzen. Mit wachsendem fiskalischem Druck und zunehmender Skepsis gegenüber Auslandsschulden wird die Krise nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch.
Ausblick
Schulden sind nicht per se schädlich – sie sind ein notwendiges Instrument für Fortschritt. Doch, wie Dr. Thegeya betont: „Es geht nicht nur um die Höhe der Verschuldung, sondern um deren Struktur, die Gläubiger und die Anpassungsfähigkeit der Bedingungen in Krisenzeiten.“ Der Weg nach vorn erfordert mehr als neue Instrumente: Er verlangt strukturelle Reformen, mehr globale Gerechtigkeit und politischen Willen auf beiden Seiten. Bleibt die Reform aus, werden Ungleichheit und Instabilität zementiert und nachhaltige Entwicklung für die 688 Millionen Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen bleibt in weiter Ferne.
Am Ende der Tagung war eines klar: Die Schuldenkrise ist keine Bedrohung der Zukunft, sondern eine akute Realität. Und die Architektur, die sie stützt, muss grundlegend erneuert werden.